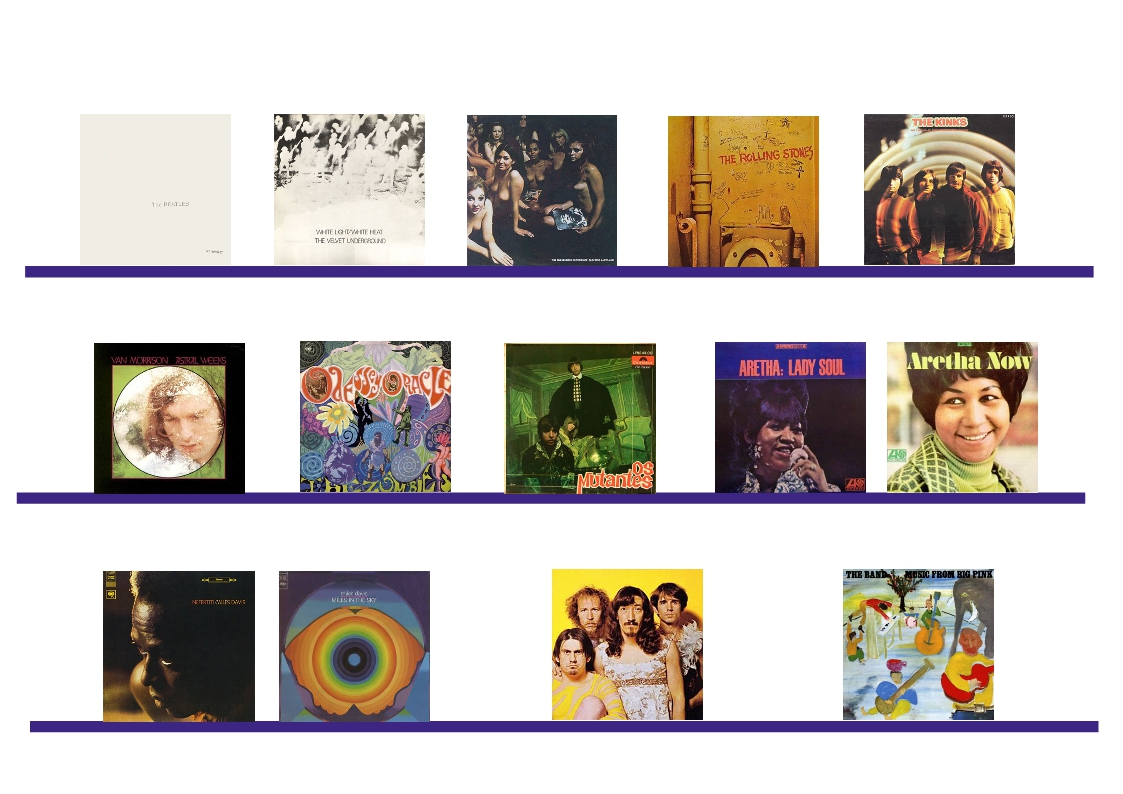Der Vietnam-Krieg wird immer mehr zum Albtraum, bei der sog. Tet Offensive der Vietnamesen werden Saigon und Huey stark zerstört, zwar scheitert der Angriff, aber die USA müssen erkennen, dass sie diesen Krieg nicht gewinnen können. Im Ort My Lai kommt es zum Massaker an 500 Zivilisten, die Armee vertuscht das zunächst, aber 1969 wird es publik. In Nigeria tobt weiterhin der Biafra-Konflikt – und die Bilder der gequälten Menschen gehen um die Welt. Der Begriff „Biafra-Kind“ wird sprichwörtlich. Der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King und John F.’s Bruder Robert Kennedy werden ermordet, der erste bemannte Flug um den Mond findet statt, die sog. Hongkong-Grippe fordert weltweit bis zu 1 Millionen Todesopfer. Bei Erdbeben im Iran und auf der Insel Celebes kommen fast 90.000 Menschen ums Leben. Der Film 2001 – A Space Odyssee kommt ins Kino. Radiohead-Sänger Thom Yorke und Mike Patton (Faith No More etc.) werden geboren, Johnny Cash kehrt nach 8-jähriger Abstinenz auf die Bühne zurück. 1968 ist musikalisch in seiner Bedeutung durchaus vergleichbar mit 1967. Es ist eines der interessantesten Jahre der Dekade, denn etliche Bands liefern nun nach dem Summer of Love den Soundtrack zu den Protesten der jungen Generation: Das Triumvirat aus Beatles/Stones/Hendrix veröffentlicht Klassiker der Rockmusik. Die Saat der Psychedelik aus den Vorjahren geht auf und findet Gehör bei jungen Menschen, die Bewusstseins-Erweiterung und Musik als Einheit betrachten und die Beatles lernen in Indien Yoga kennen und holen es nach Europa. Ob Folk (Incredible String Band), Soul (Aretha, Sly), brasilianische Popmusik (Os Mutantes), Country Rock (Byrds) oder New Orleans (Dr. John) – der letztjährige Sommer der Liebe bringt reiche Ernte ein. Auch Elvis meldet sich wieder und einige Bands, die sich nicht an blumiger Psychedelik orientieren, veröffentlichen einflussreiche Alben (The Band, Velvet Underground) Die Anzahl an sehr guten Alben sprengt den Rahmen, und die hier unten versammeltern zwölf Alben könnten leicht durch zwölf andere ersetzt werden. Für mich ist 1968 wegen der vielen Klassiker das „typischste“ 60er-Jahr. Und – Oh Wunder – viele der hier unten genannten Alben sind auch kommerziell erfolgreich. Es gibt natürlich auch 1968 ein paar mehr oder weniger namhafte „Künstler“, die ich mit Nicht-Achtung strafe: Tom Jones hat viel Erfolg, ist meiner Meinung nach aber hauptsächlich laut, und den Bubblegum Pop der Lemon Pipers finde ich nur banal. Grundsätzlich aber ist es faszinierend zu sehen, wie deckungsgleich künstlerischer Anspruch und kommerzieller Erfolg sich in den Charts abbildet, wobei – meistverkaufte Single in Der BRD ist „Mama“ von Heintje. Na ja….
The Beatles
s/t (White Album)
(Apple, 1968)

Mag sein, dass ich jetzt für einige Fans als Miesmacher gelte, aber ich finde, was das sogenannte White Album der Beatles so reizvoll und einzigartig macht, ist seine Schwäche: Seine Uneinheitlichkeit. Jeder Song auf diesem Doppelalbum ist die Darstellung der Fähigkeiten eines der vier zu diesem Zeitpunkt schon als „Rockstars“ zu bezeichnenden Protagonisten der Beatles. Es muss frustrierend gewesen sein, zu sehen, wie die Band auseinander driftete, aber man hatte sie auch nie zuvor so selbst-reflektierend und zugleich ironisch gesehen. Vor den Aufnahmen waren die Vier in Indien gewesen – und nicht alle erlebten die ersehnte spirituelle Erleuchtung. Ringo war als erster wieder abgereist, und er war es auch, der die Band während der Aufnahmen kurz verließ. Aber immerhin kehrte er auf Bitten seiner Kollegen zurück. Sowohl Yoko Ono als auch Harrison’s Frau Patti Boyd machen auf einigen Songs mit, genau wie Eric Clapton, der ein Gitarrensolo zu Harrisons bis dato bestem Song für die Band – „While My Guitar Gently Weeps“ – beisteuerte. Dann ist da „Back in the U.S.S.R“ als Botschaft an die Beach Boys, da ist die Blooze-Parodie „Yer Blues“, die man nur als Satire verstehen kann, Lennon schrieb mit „Julia“ und „Dear Prudence“ zwei seiner schönsten Balladen; es gibt die Musique Concrète Collage „Revolution No. 9“; möglicherweise sinnlos – oder vielleicht hohe Kunst ? Der Kult um die Beatles wird mit „Glass Onion“ gefeiert, „Cry Baby Cry“ klingt nach Syd Barrett. Und auch McCartney’s Songs sind besser als Alles, was er vorher gemacht hatte: Da ist der Music Hall Klopfer „Honey Pie“ oder der Proto-Metal von „Helter Skelter“ und vor Allem der wunderbare Baroque-Folk von „Blackbird“, einer seiner besten Songs, gewidmet übrigens den schwarzen Bürgerrechtlerinnen in den USA. Und sogar das etwas alberne „Piggies“ hat eine tolle Melodie. Wie man sieht (und hört), das ganze ist ein buntes Potpourrie – aber das Werk einer Truppe von Freunden ist es nicht. Dafür bekam der Fan nicht nur einen tollen Songreigen, man bekam auch optisch etwas geboten: Die Covergestaltung vom Pop-Art Künstler George Hamilton, die so revolutionär war wie die Aufnahmetechnik und das Konzept eines Doppel-Albums mit Fotos und Textbeilagen. Aber wie gesagt: Das White Album zeigt auch, wie sich die größte Band der Welt in Zeitlupe auflöst. Ein bisschen Trauer war also schon angebracht
The Velvet Underground
White Light/White Heat
(Verve, 1968)

Das Debüt von The Velvet Underground war ja schon schwere Kost, meilenweit am Publikumsgeschmack vorbei, aber White Light/White Heat (eine Anspielung auf den Speed-Rausch) ist noch ungenießbarer. VU hatten die Chanteuse Nico in die Wüste geschickt und sich von Andy Warhol verabschiedet – dessen Rat keine Kompromisse einzugehen allerdings beherzigten sie nun mit noch größerer Konsequenz als auf dem Debüt. Lou Reed und John Cale arbeiteten das letzte Mal zusammen und wenn die kreative Spannung zwischen diesen beiden doch recht unterschiedlichen Charakteren das Herz des Debüts zum schlagen gebracht hatte, dann zerfetzt diese Spannung hier die Eingeweide. Aber Velvet Underground waren eine Band, die ein Monster durchaus zu einer dunklen Schönheit formen konnten. Unter all den White Noise-Ausbrüchen, übersteuerten Bässen, kreischenden Violas, primitiven Drums und abgeklärten Vocals lauert verstörende Schönheit – und sogar Melodie. Da wird lustvoll experimentiert (Der 17-minütige Titelsong auf der zweiten Seite der LP ist ein Meilenstein des experimentellen Rock), da gibt es mit „Here She Comes Now“ noch einen fast radiotauglichen Song, da sind seltsame erotische Unterströmungen, und da ist sogar Humor, – auch wenn man ihn suchen muß. White Light/White Heat ist vordergründig natürlich hässlicher, auch weil es schlechter produziert ist als das Debüt, und es erreichte gerade mal zwei Wochen lang die hintersten Plätze der US Top 200 (…man kann auch sagen immerhin!! ) Aber es ist in seiner konsequenten Anti-Ästhetik fast noch innovativer und aufregender als das inzwischen so kanonisierte Debüt.
The Jimi Hendrix Experience
Electric Ladyland
(Track, 1968)

der auch The Who Sell Out Gemacht hat

Jimi Hendrix mag ja meist als bester Gitarrist aller Zeiten bezeichnet werde, aber bei genauem Hinsehen sind es weniger seine instrumentalen Fähigkeiten, die seinen Ruhm begründen, als vielmehr sein Talent als Showman, als Visionär des psychedelischen Rock und dann erst als innovativer Gitarrist. Mit seinem Debüt hatte er der Musik der Mitt-Sechziger eine neue Richtung gegeben, Axis: Bold as Love war eine Ergänzung des Debüts aber mit seinem dritten Album wollte Hendrix seinen geliebten psychedelisch/ futuristischen Blues in neue Dimensionen katapultieren. Electric Ladyland wurde zunächst in London in Angriff genommen, dann ins New Yorker Plant Studio verlegt, das Hendrix gleich für mehrere Monate blockbuchte – was die Kosten für das ambitionierte Doppelalbum in schwindelnde Höhen trieb. Es sollte sein letztes Album mit der Experience – und sein vollkommenstes Studioalbum werden, mit Cosmic-Blues wie „Voodoo Chile“, mit dem ambitionierten „1983… (A Merman i Should Turn to Be)“, das perfekt den Geist seiner Zeit – und besser noch, den Spirit Hendrix` zu dieser Zeit einfängt. Das folgende „Moon, Turn the Tides…“ bleibt mit Ambienthaften Klängen in diesem Vibe genau wie das ineinanderfließend folgende „Still Raining…, bei dem Hendrix seine Gitarre nur noch wie ein träumendes Kind vor sich hin murmeln lässt. Und natürlich muß man auch seine Version von Dylan’s „All Along the Watchtower“ nennen, welche diesem so sehr gefiel, dass er den Song ab da nur noch in diesem Arrangement spielte. Andererseits sind auf dem Dopplealbum auch ein paar arg in ihrer Zeit gefangene Tracks wie etwa „Long Hot Summer Night“ oder „Rainy Day, Dream Away“. Aber geschenkt: Hendrix war auf seine schludrige Weise Perfektionist – so sehr, dass er sich bald in der Trio-Besetzung der Experience eingeengt fühlte und diese auflöste – andererseits war er bald von den seinerzeit offenbar obligatorischen Drogen so sehr gezeichnet, dass er seine Visionen vermutlich voller Frustration in Acid-Rauch aufgehen sah. Es gibt die Spekulationen, was aus ihm geworden wäre, wäre er nicht knapp zwei Jahre später nach einem Mix aus Alkohol und Tabletten im Schlaf an Erbrochenem erstickt. Ich glaube, er wäre entweder – ähnlich wie Clapton – irgendwann nur noch als Sebst-Plagiat unterwegs gewesen, oder er wäre – ähnlich wie Sly Stone – einer dieser Musiker, die nur noch als verlorenes Drogenopfer wahrgenommen werden. Electric Ladyland allerdings bleibt völlig zu Recht ein glorreiches Symbol seiner Zeit – mit einem Cover übrigens, das Hendrix selber überhaupt nicht gefallen hat: Er bevorzugte die Version mit seinem Konterfeit auf dem Cover und fand die nackten Ladies unpassend… kaum zu Glauben
The Kinks
The Kinks Are The Village Green Perservation Society
(Pye, 1968)

Lange Zeit galt Davies‘ Konzept-Album nicht viel, mittlerweile gibt es The Village Green Perservation Society in diversen Luxus Editionen. Damals war es der erste große Fehlschlag der Kinks, die ja zuvor mit brillianten Singles zu den großen britischen Bands aufgeschlossen hatten. Mit dem auf diesem Album nicht enthaltenen „Days“ endete die Phase der Hits. Davies entwarf ein Vorstadt-Idyll, das an seine Herkunft aus Muswell Hill angelehnt ist. Bedauern und zugleich Sentiment über den Verfall eines fiktiven „Good Old England“ gaben die Grundstimmung vor, und waren vor allem das Storyboard für wunderbar skizzierte Figuren. Die Songs verdanken mehr der Tradition von Noel Coward als der Rock-Musik. Erst viel später wurde Ray Davies – z.B. mit dem Film „Absolute Beginners“ – als Chronist des britischen Kleinbürgertums gefeiert, aber hier sind alle Charaktere schon angelegt – liebevoll und friedlich – in einem England das es so nie gegeben hat, in dem der Tee immer um 5 Uhr serviert wird. Die Musik dazu war fein durch-arrangiert, wenn auch mit dem immer etwas dünnen Sound der Kinks, bei dem im Idealfall eben das Wenige mehr ist. Den Trend der Zeit allerdings bediente er damit nicht – hier gab es keinen „Street Fighting Man“ und niemand war „Dazed and Confused“. Das Album ist auf eine sehr britische Art altmodisch und zugleich zeitlos, was letztlich die Klasse von The Village Green.. ausmacht. Es klingt manchmal ein bisschen wie ein Solo-Album von Ray Davies und heute auch wie eine Art Best Of Kopplung, weil viele der Songs so schlüssig sind und gleichzeitig klingen, als sollte man sie schon ewig kennen. Und darin ist es natürlich typisch Kinks.
The Rolling Stones
Beggars Banquet
(Decca, 1968)
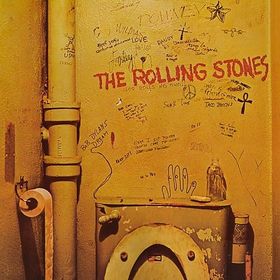

Im Jahr zuvor hattten die Stones sich dem herrschenden Trend Psychedelik mit Their Satanic Majesties Request angepasst – mit durchwachsenem Ergebnis (und auch wenn das Album bis heute seine Liebhaber hat…), aber anscheinend hatten sie keine Lust mehr, sich anzubiedern, und machten nun wieder das, was sie am besten konnten – sie nahmen den Blues und schoben ihn wieder in ihr Universum. Beggars Banquet ist eine Rückkehr zu alter Stärke und mehr – es ist die Ausformulierung all dessen, was sie davor gemacht hatten. Dabei waren die Voraussetzungen scheinbar nicht ideal: Brian Jones‘ Drogensucht war außer Kontrolle, er erschien nur noch dann und wann zu den Sessions und seine Parts sind nur noch hier und da auf dem Album verstreut. Dafür übernahm Keith Richards nun um so mehr Verantwortung – und er und Mick Jagger schrieben nun große Songs im Akkord. Da sind Anlehnungen an den guten alten Delta-Blues bei „Salt of the Earth“ oder „No Expectations“ und da gibt es das Cover von Robert Wilkins „Prodigal Son“, da sind die vom Hank Williams Liebhaber Keith Richards eingeführten Country-Elemente bei „Dear Doctor“. Die bekanntesten Stücke sind wohl der unsterbliche Opener „Sympathy for the Devil“ mit Dschungel-Drums und feinen Gitarren-Riffs und natürlich der „Street Fighting Man“ – ihr Kommentar zur Jugendrevolte. Es gibt den düsteren „Stray Cat Blues“ – das Album ist voller ikonischer Riffs und gilt zu Recht als eines ihrer Besten. Die Veröffentlichung des im Frühjahr erstmals mit Produzent Jimmy Miller aufgenommenen Albums verschob sich allerdings bis in den Dezember – bis kurz nach dem Erscheinen des Weissen Albums der Beatles. Decca akzeptierte das „unanständige“ Toilettenwand-Cover nicht und setzte sich letztlich mit dem Cover mit dem altmodischen Schriftzug auf hellem Grund durch. (…traurig, aber eigentlich zählt ja nur, was drin ist). Mit Beggars Banquet begann eine fünf Jahre währende Kreativperiode der Stones, in der es Klassiker regnen würde und in der der Status der Band zementiert wurde.
Van Morrison
Astral Weeks
(Warners, 1968)
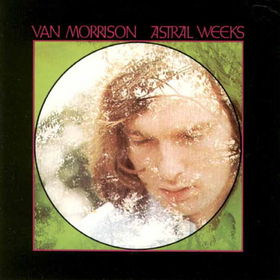
Joel Brodsky, der etliche Portraits geschossen hat
Van Morrison war nach dem Tod seines bisherigen Label-Chefs Bert Berns frei zu tun was er wollte, bekam einen Vertrag bei Warner und nahm in New York in nur zwei Tagen mit Jazz-Musikern aus dem Umfeld von Eric Dolphy und Charlie Mingus dieses einzigartige Album auf. Er spielte den Musikern seine Songs auf der Gitarre vor und ließ ihnen dann freie Hand. Die Songs auf Astral Weeks mit ihrer Mischung aus Folk, Jazz, Blues und Klassik gehören zum Besten, was Van Morrison je aufnehmen sollte, ihre poetische Komplexität und musikalische Freiheit ließen die Kritiker in Lobeshymnen ausbrechen – der kommerzielle Erfolg jedoch blieb aus. Und natürlich haben ellenlange, erzählerische Songs wie „Madam George“ oder „Cyprus Avenue“ bei aller melodischen Feinheit kein „Hitpotential“. Aber da ist immerhin „Sweet Thing“, das zum Live-Favoriten wurde, oder das nachträglich mit Orchesterbegleitung aufgepimpte „The Way Young Lovers Do“, das wegen seiner brennenden Intensität vielleicht zu schwere Kost für irgendwelche Charts ist. Astral Weeks existiert als singuläres Phänomen, es enthält keine Antworten, eröffnet nur Fragen, bietet keine Lösungen, nur Vorschläge, aber es öffnete im Nachhinein Türen für hunderte Künstler. Die Einzigartigkeit und subtile Schönheit dieses Albums wurde später höchstens noch von einer handvoll anderer Alben erreicht – auch Van Morrison bewegte sich danach meist auf öfter begangenen Pfaden, höchstens seine Alben Veedon Fleece und Common One sind nahezu so far out wie dieses. Astral Weeks klingt als wäre es schon 100 Jahre alt – oder als würde es erst in 100 Jahren gemacht werden. Einmal im Leben sollte man es gehört haben.
The Zombies
Odessey & Oracle
(CBS, 1968)

Im Kanon der ’68er Alben ist dieses immer wieder eines der ganz hoch bewerteten – und doch ist es zugleich eines der am wenigsten bekannten… Was meiner Meinung nach verschiedene Gründe hat: Zur Zeit der Veröffentlichung von Odessey & Oracle existierte die Band nicht mehr, der Hit dieses Albums – „Time of the Season“ – war mit den vorherigen, beat-informierten und an den britischen Vorbildern orientierten Singles kaum zu vergleichen und bei den Bandmitgliedern war nach den Aufnahmen zu Odessey & Oracle die Luft raus – also gab es keine Live-Promotion. Auch die Plattenfirma war wohl vom Erfolg der Single zu diesem Album so überrascht, dass sie die Band nicht weiter ermutigen konnte oder wollte, ihre Karriere fortzusetzen. Zu den Aufnahmen hatte nur ein kleines Budget zur Verfügung gestanden, aber die Zombies hatten wohl vorgehabt, ein letztes Zeichen ihrer Klasse zu geben, und dazu die Trends der Stunde in ihren Sound einfließen zu lassen. Dass es sich bei ihnen um eine Kombination äußerst talentierter Musiker handelte, hatten die Vorjahre schon gezeigt: Colin Blunstones weiche Stimme, immer in perfekter Harmonie mit denen seiner Mitstreiter, Rod Argents jazzige Keyboards, und dazu auf diesem Album nun eine Hinwendung zum Baroque-Pop, mit Songs, die doch eigentlich für eine komplette Karriere hätten reichen müssen. Das ist das Erstaunliche an diesem Album: Neben dem majestätischen Über-Hit, der bis heute seine Wirkung tut, wurden Songs wie „Brief Candles“, das nostalgische „Beechwood Park“ oder das melodramatische „Maybe After He’s Gone“ kriminell ignoriert. Das Album ist ein zeitloses Meisterwerk herbstlicher Popmusik, die Band hatte ihr Ende vor Augen, und die daraus entstehende Melancholie floß in die Atmosphäre ein. Mag sein, dass Odessey & Oracle genau deswegen seinerzeit so wenige Hörer fand, es war vielleicht etwas ZU melancholisch. Inzwischen hat das Album einen Kult-Status, zu dem auch der bewusst falsch geschriebene Albumtitel beiträgt… aber ein Kultstatus ist eigentlich viel zu wenig – es ist ein Meisterstück, das gleichberechtigt neben (nur zum Beispiel…) dem Weissen Album der Beatles stehen sollte.
Os Mutantes
s/t
(Polydor, 1968)

Das erste Album von Os Mutantes muss man heute sicher wegen der vergleichsweise obskuren Herkunft (Brasilien) und der Zeit, die seit seinem Erscheinen vergangen ist, genauer beschreiben. Das heißt – vergleichen mit dem, was aus 1968 noch bekannt ist. Also: Man stelle sich die psychedelischen Songs der Beatles mit portugiesischen Lyrics vor, gesungen von einer Frau, ergänzt um Bossa Nova und Samba-Rhythmen sowie um all das, was amerikanische Psychedelik spannend machte – also um Heavy Psych, um verqueren Folk und Musique Concrete. Und man muss bedenken, dass Os Mutantes sich mit dieser heute vergleichsweise „unpolitisch“ klingenden Musik im von Militärs regierten Brasilien in große Gefahr begaben – tatsächlich in Gefahr um Leib und Leben – nicht umsonst mußte Inspirator und Kollege Caetano Veloso zur selben Zeit ins Londoner Exil fliehen. Aber der politische Hintergrund, vor dem dieses Album steht. mag noch so bedrückend sein. Das Debüt der beiden Baptista Brüder und ihrer Sängerin Rita Lee klingt zu keiner Zeit düster oder lebensunfroh, im Gegenteil, hier sprudeln die Ideen genauso munter wie die Melodien, man sieht regelrecht, wie das Trio auf der Nase der Soldaten und Polizisten herumtanzt. Und die erfreulich mutige Respektlosigkeit ist noch nicht Alles: Die Songs, der Ideenreichtum und die Experimentierlust, die in jedem Song zum Ausdruck kommen, machen das Album zu einem der ganz großen Psychedelik-Pop Alben seiner Zeit. Natürlich war Os Mutantes seinerzeit wegen seiner Subversivität nur ein bescheidener Erfolg vergönnt, man darf nicht vergessen, dass es auch in Brasilien genug Konservative gab, denen die Ideen von Love and Peace eine Greuel waren – und die hatten seinerzeit Macht und Gewalt unter sich. Aber Interessierte und Mutige in Brasilien hatten eine Inspiration, die noch lange gelten würde. Nicht dass es auf Os Mutantes Hits hagelt. Aber es ist voller gewagter Ideen und strotzt vor Inspiration, Lebensfreude und Lust an der Musik. Kein Wunder, dass in den Neunzigern etliche namhafte Künstler aus dem Independent Bereich der USA und Englands das Album feierten. Und ich weiss es ja nicht – aber ich vermute Animal Collective haben dieses Album im Studio.
Miles Davis
Nefertiti
(CBS, Rec. ’67, Rel. 1968)
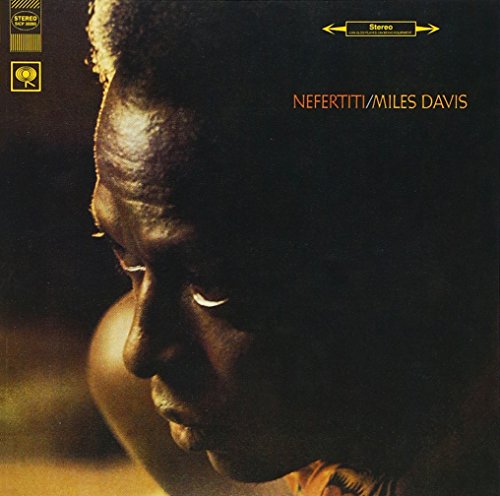
Jazz schien Ende der Sechziger Jahre ans Ende der Innovation gelangt zu sein. Coltrane tot, die Free-Jazz-Szene macht zwar revolutionäre und spannende Alben, entfernte sich damit aber inzwischen auch von den Massen – nur Miles Davis hatte offenbar ein Rezept, den HardBop so zu modernisieren, dass er den Appetit eines neuen (Rockmusik)-Publikums anregen konnte. Dazu hatte er sein sogenanntes „zweites Quintett“ um sich, bestehend aus den Musikern, die ihm auf seinem Weg folgen würden, um daraus ihre eigene Interpretation einer „Fusion“ aus Jazz und Rock zu entickeln. ’68 veröffentlicht Davis aber zunächst mit Nefertiti, das letzte akustische Album dieser Phase – ein Album, auf dem er anscheinend die Idee verfolgt, das Rhythmusgespann aus Tony Williams (dr), Ron Carter (b) nach vorn zu stellen, Wayne Shorter’s Saxophon und seine Trompete sanft darüber schweben zu lassen und den Keyboarder Herbie Hancock als Vermittler dazwischen spielen zu lassen – was den eigenartigen Effekt erzeugt, dass die wundersame Schönheit der Kompositionen auf dem rasanten Rhythmus-Fundament regelrecht irritiert. Vielleicht hört sich das anstrengend an, aber insbesondere das Titelstück und das gleichfalls von Wayne Shorter komponierte „Fall“ klingen zwar rastlos, sind zugleich aber von einer überraschenden Ästhetik. Shorter empfahl sich hier endgültig nicht nur als phänomenaler Saxophonist, sondern vor Allem als großer Komponist. Und Miles ließ seine Musiker immer wieder frei über die Themen improvisieren – ab und zu glitten sie ab in die z.Zt. angesagte Atonalität, aber immer fanden sie den Weg zurück in die Bahnen des PostBop und des Blues. Zwei Tage vor den Aufnahmen zu „Fall“. „Riot“ und „Pinocchio“ war John Coltrane gestorben, und Davis und seine Begleiter, die allesamt Coltrane kannten und bewunderten, werden seine Musik und vor Allem seinen kreativen Spirit im Sinn gehabt haben
Miles Davis
Miles in the Sky
(Columbia, 1968)

Nefertiti kann man als das Album an der Schwelle zum Fusion-Jazz bezeichnen – und fünf Monate später öffnet Miles in the Sky die Tür zum Fusion-Jazz noch weiter. Das Album ist weit weniger bekannt – und anerkannt – als seine Nachfolger – eben weil der Schritt zum elektrifizierten Jazz noch nicht komplett gegangen ist – aber hier ist auf der Shorter-Komposition „Paraphernalia“ erstmals mit George Benson ein elektrischer Gitarrist an vorderster Front dabei und auch Bassist Ron Carter setzt nun verstärkt den E-Bass ein. Die erste Seite des Albums zeigt, wo der Weg hinführen soll, Tony Williams spielt Funk-Grooves, Herbie Hancock bedient das E-Piano, die Musik ist dicht und spannend – und darüber schweben Shorter und Davis noch im PostBop Modus. Noch ist das System also nicht austariert, noch klingt die Musik unentschieden und die Reife vom Nachfolger In a Silent Way ist noch nicht erreicht. Auf der zweiten Seite der LP wenden sie sich wieder stärker dem PostBop zu, aber Tony Williams‘ „Black Comedy“ zeigt eine sehr fremde Form des PostBop, der Drummer versucht sein dynamisches und unvorhesehbares Spiel in einen Song zu übersetzen, und bei Davis‘ „Country Son“ löst sich die Musik in freie Improvisation auf. Schon der sehr eigene Ansatz auf Nefertiti wurde als „Free Bop“ bezeichnet – hier passt der Begriff noch besser. Miles in the Sky (…der Titel war angeblich als Anspielung auf „Lucy in the Sky with Diamonds“ von den Beatles gedacht…) ist ein transitional album, und als solches extrem interessant – und Miles Davis machte zu jener Zeit kein einziges schlechtes Album.
Aretha Franklin
Aretha: Lady Soul
(Atlantic, 1968)

Beim verfassen des Hauptartikels 1967 habe ich Aretha Franklin’s I Never Loved a Man… ausser Acht gelassen – zugunsten von James Carr, dem größten Soul-Sänger den keiner kennt. Aber ich dachte mir auch: Aretha hat danach noch eine ganze Reihe hervorragender Alben gemacht: Und tatsächlich gibt es ’68 wieder zwei hervorragende Gründe, diese Frau zur „Queen of Soul“ zu krönen. Insbesondere das programmatisch benannte Lady Soul steht dem Klassiker von ’67 in Nichts nach. Die Musiker im Hintergrund allein garantieren Klasse: Der junge Eric Clapton spielt auf der Ballade „Good to Me As I Am to You“ mit, Studio-Asse wie Spooner Oldham und Bobby Womack machen mit, die komplette Bläser-Sektion von Atlantic Records ist versammelt – und Aretha war in der Form ihres Lebens. Ihrer Stimme schien seit dem letzten Jahr entfesselt, man musste ihr nur noch ein paar gute Songs vorsetzen. Und das ist auf Lady Soul gewährleistet: Don Covay’s „Chain Of Fools“ ist in ihrer Version so fest zementiert wie das letztjährige „Respect“, bei „(Sweet Sweet Baby) Since You’ve Been Gone“ sagt sie mal eben das Motown ABC auf, „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“ und ihr Impressions-Cover „People Get Ready“ kann man nur als monumental bezeichnen, und James Brown kann sein „Money Won’t Change You“ auch nicht energischer vortanzen. Lady Soul wurde zum Crossover-Hit, erreichte die Spitzenplätze in den Pop-, Jazz- und Black Music Billboard-Charts. Also kein Qualitäts-Gefälle zu I Never Loved A Man…. und besser als dessen Nachfolger Aretha Arrives…
Aretha Franklin
Aretha Now
(Atlantic, 1968)
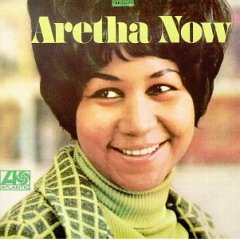
Dass der Lady Soul-Nachfolger Aretha Now wieder als ein ganz klein bisschen schwächer angesehen wird, ist Gemecker auf sehr hohem Niveau. Das Album wurde wenige Wochen nach den Sessions zu Lady Soul aufgenommen – mit fast identischem Personal und wieder unter der Ägide von Jerry Wexler und Engineer Tom Dowd. Der Opener „Think“ ist ein mit „Respect“ ´und „Chain Of Fools“ vergleichbarer Signature Tune – diesmal allerdings von Aretha selber verfasst. „I Say a Little Prayer“ war von Burt Bacharach für Dionne Warwick geschrieben worden, Aretha klaute ihr den Song, Don Covay’s „See Saw“ war wieder so ein groovender Soul-Tune, der durch Aretha’s überragende Gesangs-Technik den zusätzlichen Kick bekam, der ihn über das Normalmaß heraushob. Eigentlich sind es nur kleine Nuancen und Dehnungen, die ihre Stimme über den Rest erheben – und die Tatsache, dass bei ihr Alles so mühelos klingt. Eine Eigenschaft, die den meisten „Soul“ und R’n’B Hochleistungs-Sängerinnen der 80er und 90er völlig entgangen zu sein scheint. Mit „I Can’t See Myself Losing You“ gibt es den nächsten Hit als Album-Closer, Sam Cooke’s „You Send Me“ oder Isaac Hayes‘ „I Take What I Want“ sind auf dem gleichen hohen Niveau. Wenn das Routine ist, mag ich Routine. Tatsache ist: Aretha Franklin liefert in den Jahren zwischen ’67 und ’72 mindestens fünf Klassiker des Soul. Und ’68 gibt es gleich zwei davon: Respekt.
The Mothers of Invention
We‘re Only In It For The Money
(Verve, 1968)


Ein heute gerne sentimental zugenebelter Aspekt der Hippie Zeit ist, dass das Bild von Love & Peace nach kurzer Recherche schnell hässliche Kratzer bekommt. Vietnam-Krieg, Martin Luther King’s und Robert Kennedy’s Ermordung, brennender Rassismus im weissen Durchschnitts-Amerika, die erkennbare Zersetzung aller Hippie Ideale, die immer schlechteren Drogen und die eitlen Schwätzer und Möchtegern-Gurus, von denen sich zugekiffte Hippies ausnutzen ließen – Der geistig sehr wache und kontrollierte Frank Zappa hatte allen Grund, die Ideale seiner Generation in Frage zu stellen. Und das tat er auf unnachahmliche Art mit dem Gesamtkunstwerk We’re Only In It For the Money. Da ist der eindeutige Titel, da ist das Cover und natürlich das Innencover, das die Ikone Sgt. Peppers persifliert. Da sind seine beissend ironischen Lyrics – die gerechterweise nicht bloß den Hippie, sondern auch das Establishment auf’s Korn nehmen. Dies ist ein Album, das sagt: „Der Status Quo funktioniert nicht, und „…to tune in and drop out“ ist auch keine Lösung.“ Und so ist We’re Only In It For the Money giftiges Acid – zusammengebaut aus Sound-Collagen a la Stockhausen, Spoken Word Passagen, die an Monty Python erinnern, gewagten musikalischen Experimenten, virtuosen Solo Passagen, die direkt wieder von scheinbar sinn-entleertem Noise unterbrochen werden. Na ja, und noch einmal: Die Texte? „All young people are poor unfortunate victims of systems beyond their control!“ „I‚m really just a phony but forgive, I’m STONED!“ „Hi boys and girls, I’m Jimmy Carl Black, the Indian of the group!“ … oder die paar Fragen an den „Flower Punk“, ehe dessen Kopf nach einer Dosis STP (synthetische Droge, die der Grateful Dead Tonmann Owsley Stanley ’67 in Haight Ashbury populär machte…) explodiert und sich über den Plattenspieler verteilt. Zur Information: Zappa, der Gitarrist und Komponist macht auf diesem Album Pause, Zappa, der Innovator ist präsent – und Zappa, der Mensch ist boshaft, zynisch und voller Verachtung für die Dummheit der Menschheit. Und genau so wollen wir ihn doch?
The Band
Music From Big Pink
(Capitol, 1968)
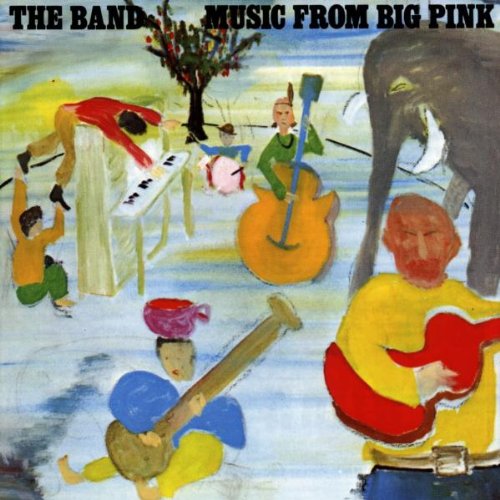
Aufgenommen im Keller ihres – wie auf dem Back-Cover zu sehen in der Tat rosafarbenen – Hauses in Woodstock, war Music From Big Pink nominal ein Debüt-Album, faktisch nur eine Etappe in der Geschichte einer Gruppe, die bereits Ronnie Hawkins als “The Hawks” begleitet hatte, dann mit Bob Dylan tourte ,seine Elektrifizierung mit initiierte und mit his Bobness die legendären Basement Tapes im selben Zeitraum einspielte, in dem sie dieses Album aufnahmen. Auf Music From Big Pink firmierten sie nun erstmals eigenständig als “The Band” – und machten gleich insbesondere auf andere Künstler gewaltig Eindruck. Keiner hatte eine solche LP erwartet, selbst wenn sie von der Band des großen Dylan kam (der nach dem dubiosen Motorradunfall von 1966 nur ein paar Auftritte gehabt hatte und ansonsten erst einmal heimlich den Schritt Richtung Country-Musik tat) Eine solche Verquickung von uraltem Folk, Country, Soul und auch Rock im Bandgefüge war zu Zeiten von Psychedelic und Acid revolutionär und klang zugleich so alt wie das Alte Testament. Robbie Robertsons “The Weight” – seither oft gecovert – ist der herausragende Song, aber natürlich sind auch auf diesem Album noch etliche andere Titel, die den Zuhörer weitertragen: Da ist der von Dylan und Schlagzeuger Richard Manuel geschrieben Opener „Tears of Rage“. Gemeinsam mit Bassist Rick Danko trägt Dylan auch zu „This Wheel’s on Fire“ bei und spendet sein „I Shall Be Released“ als Closer – Dylan als Klammer sozusagen. Ungemein kraftvoll – und fast wieder Rockmusik – das ebenfalls von Robertson geschrieben „Chest Fever“. Noch ist The Band eine Gruppe Gleichberechtigter – zumal alle Musiker sich bei den Credits und an den Instrumenten abwechseln. Die Lockerheit bei den Sessions, der nicht vorhandene „kommerzielle“ Druck und zugleich die Entschlossenheit, eine Art neue „alte“ Musik zu schaffen, ist dem ganzen Album anzuhören. Noch mag das Spielverständnis nicht das Niveau erreicht haben, welches die folgende LP – The Band – zum um ein paar Grade besseren Werk machen sollte, aber andererseits ist Music from Big Pink die frische Begeisterung und Neugier anzumerken, die deutlich zeigt, dass den Musikern bewusst war, dass sie sozusagen „altes Land“ neu betraten. Es ist eines der paar Alben, die den Begriff Americana in den kommenden Jahrzehnten via Inspiration definieren würden. Und auch dieses Album ist ein geschlossenes Gesamtwerk, als komplette LP zu hören.
Oh Mann, diese Auswahl…
Ja – und wer mag, der kann für die 12 ausgewählten Künstler und ihre ’68er Alben schnell Alternativen finden. Ich kann das ja auch. Da könnte statt Odessey & Oracle S.F. Sorrow von den Pretty Things gewählt werden. Nico’s Marble Index ist ein düster-abseitiges Meisterwerk. Aber ich habe an dessen Stelle VU’s White Light/ White Heat lieb. Aber nicht lieber… Der krachende europäische Jazz vom Peter Brötzmann Octet auf deren Machine Gun ist eine laute Explosion, die jeder mal hören sollte, die Notorious Byrd Brothers fehlen hier auch. Und und und… Und ich musste etliche großartige Alben ausschließen – was gerade in einem Jahr wie 1968 schwer ist. Dafür werde ich diese Alben in den Themen-Artikeln nennen, loben, lieben. Die Frage war einfach: Bleibe ich bei dem Prinzip der 12? Ich mache das in den Hauptartikeln so. Basta.